Unterschätzte Gefahren, Teil 1
Seit den tragischen Ereignissen am Laila Peak in Pakistan werde ich immer wieder mit der Frage nach den Gefahren am Berg konfrontiert. Nehmen sie zu? Werden Gefahren in den Gebirgen dieser Welt unterschätzt? Welche Rolle spielt der Klimawandel? Und was sagen die Statistiken dazu?
Seit 1881, dem Erscheinungsjahr von Emil Zsigmondy Standardbuch, „Die Gefahren der Alpen“, werden in der Literatur zwei grundsätzliche Arten von Gefahren unterschieden. Einmal diejenigen, welche die Natur im Gebirge immer für ihre Besucher bereithält. Wir sprechen bei ihnen von objektiven Gefahren. Das ist zum Beispiel das Wetter: Also Regen, Schnee, Kälte, Gewitter, Nebel, Sturm. Außerdem Stein- und Eisschlag, die Gefahr von Lawinen, Wechtenabbrüchen, Gletscherspalten und noch einiges mehr.

Wenn ich mir dieses Bild anschaue, läuft mir noch heute ein Schauer über den Rücken. Es zeigt mich im Vorstieg in der Franzosenroute am Alpamayo in Peru. Wir wussten natürlich um die Bedrohung durch die Eispilze über uns. Denn diese Route heißt nicht deshalb so, weil französische Alpinisten diesen Aufstieg als Erste gemacht haben, sondern weil eine französische Seilschaft durch Eisschlag in dieser Route ums Leben kam. Aber wir waren zeitig unterwegs, und wir waren sehr schnell, um rasch aus der Gefahrenzone wieder raus zu sein.
Auf diese Gefahren müssen wir uns einstellen, wenn wir in die Berge gehen, denn sie sind allgegenwärtig. Aber sie sind auch berechenbar. Es stimmt einfach nicht, dass wir den objektiven alpinen Gefahren schicksalhaft ausgeliefert wären.
Die zweite Art von Gefahren, mit denen wir es im Gebirge zu tun haben, sind die subjektiven Gefahren. In meinen Augen stellen sie das bei weitem größere Problem dar, denn die subjektiven Gefahren gehen von uns Menschen aus. Sie sind weniger berechenbar, vor allem wenn wir in einer Gruppe unterwegs sind, und das ist ja fast immer der Fall. Kleine Bemerkung am Rande: Von manchen Autoren wird diese Zweiteilung kritisiert. Ich aber finde diese Unterscheidung vernünftig, plausibel und vor allem in der Praxis auch gut nachvollziehbar.

Am Ende der Kräfte. Die Erschöpfung war hier so groß, dass drei Mann nötig waren, um ihn Meter für Meter wieder den Berg hinunter zu bekommen.
Die subjektiven Gefahren sind zum Beispiel mangelhafte Erfahrung, welche meiner Ansicht nach die am meisten relevante ist. Selbstüberschätzung, Leichtsinn, die Unfähigkeit, aus den zur Verfügung stehenden und sich oft rasch ändernden Informationen tragfähige Entscheidungen zu treffen, sind die Folgen.
Dazu kommen lückenhafte Kenntnisse durch einen schlechten Ausbildungsstand. Unzureichende technische Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit der Ausrüstung sowie bei der Bewältigung der Anforderungen, welche die gewählte Route an den Alpinisten stellt. Fehlende, mangelhafte oder falsche Ausrüstung gehört ebenso zu den subjektiven Gefahren, wie auch eine wenig stabile Psyche sowie eine ungenügende körperliche Fitness. Beides muss zur gewählten Route passen.

Diese Beinahe-Katastrophe war nicht etwa der Kälte geschuldet. Es waren schlicht die falschen Handschuhe, die zu diesen Erfrierungen geführt haben. Doch glücklicherweise sind hier keine bleibenden Schäden zurückgeblieben.
Darüber hinaus ist die Gruppendynamik eine äußerst wesentliche subjektive Gefahr, welche sehr häufig zu fatalen Fehlentscheidungen führt. Auch hier sind die in 35 Jahren gemachten Erfahrungen vor allem bei meinen zahlreichen Führungstouren in Nepal und Pakistan der Grund für diese Einschätzung.
Heutzutage gewinnen diese subjektiven Gefahren meiner Ansicht nach durch eine Reihe von Umständen zunehmend an Bedeutung. Die sozialen Netzwerke sind überfüllt mit Bildern und Videos von fröhlichen Menschen, welche bei bestem Wetter auf schöne Berge steigen und davon schwärmen, wie toll doch diese Erfahrungen sind. Man vergöttert Leute, die mit ihren gestählten Körpern seilfrei durch 1000-Meter-Wände klettern und dabei extreme Risiken in Kauf nehmen. Doch wenn man dann sein eigenes armseliges Bergsteigerleben betrachtet, grassiert die Angst vor der totalen Bedeutungslosigkeit. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Das leistet der „Das-muss-ich-auch-tun-Mentalität“ Vorschub.

Auch hier ist die Sache klar. Der Khumbu-Eisfall am Fuße des Mount Everest ist tatsächlich kreuzgefährlich. Die Eisschlaggefahr ist allgegenwärtig. Die Sherpas haben an den besonders heiklen Stellen Gebetsfahnen aufgehängt und vom Dalai Lama gesegneten Reis verstreut, um die Berggötter milde zu stimmen. Das Foto entstand während meiner privat organisierten Expedition zum Everest im Jahr 2005.
Die Realität in der Urnatur der Gebirge sieht jedoch oft anders aus als auf diesen Fotos und Videos. Doch davon bekommt man häufig keine Bilder zu sehen. Erstens muss man in schwierigen und heiklen Situationen bei schlechten Bedingungen einen klaren Kopf behalten, Entscheidungen treffen, seine Angst niederkämpfen. Da denkt man an alles Mögliche, nur nicht ans Filmen oder Fotografieren.
Und wenn man es doch tut, kommen Bilder dabei heraus, die höchstens abschrecken. Und Leute abschrecken, wenn man doch Aufmerksamkeit und Bewunderung sucht, ist da eher kontraproduktiv. Da wird man womöglich noch für verrückt erklärt. Also lässt man den Fotoapparat bei miesen Verhältnissen lieber gleich ganz stecken.

Bewegt man sich auf einem Gletscher, so wird man sich immer mit der Tatsache auseinandersetzen müssen, dass man auf offene und verdeckte Spalten trifft. Doch mit viel Erfahrung und den nötigen Kenntnissen bezüglich einer Bergung nach einem Spaltensturz, wird auch diese objektive Gefahr beherrschbar. Das Foto ist während der Expedition zum Hidden Peak 2012 auf dem Gasherbrum-Gletscher aufgenommen worden.
Meiner Ansicht nach ist der Druck, auch etwas besonderes, einmaliges machen zu wollen, also der Bedeutungslosigkeit wenigstens ein bisschen zu entkommen, eine der heutzutage womöglich am meisten unterschätzten Gefahren, die in dieser Form eine völlig neue Dimension angenommen hat. Die Aufmerksamkeitswährung, gezahlt in Klicks und Likes und einer hoffentlich stattlichen Anzahl von Followern, ist gegenwärtig nicht nur bei den von Sponsoren abhängigen Profis heiß begehrt. Leider wird es immer aufwendiger, sie auch zu bekommen.
Und genau hier liegt meiner Ansicht nach das Problem. Sozialisiert vor dem Smartphonebildschirm und in der geschützten Umgebung von Kletterhallen und -gärten ist es nicht so einfach zu realisieren, dass man sich da draußen im Gebirge plötzlich in einer Umgebung befindet, die voller realer Gefahren ist, schon ganz und gar, wenn man sich in die Vertikale begibt.

Dieses Bild zeigt mich in der Lhotseflanke am Everest in etwas über 7400 m Höhe. Der Windchill ließ hier die gefühlte Temperatur häufig auf unter minus 40 °C fallen. Das bedeutet immer große Erfrierungsgefahr. (Foto: Lakpa Gelbu Sherpa)
Doch diese Gefahren kann man sehen, einschätzen, ihnen mit einer ausgefeilten Strategie und Taktik entgehen. Und wenn genau das nicht funktionieren kann, muss man verzichten. Aber um dazu in der Lage zu sein, sind vor allem zwei Dinge von großer Bedeutung: Geduld und Beharrlichkeit.
Diese beiden Eigenschaften braucht man, um sich über Jahre hinweg mit kleinen Schritten das nötige Wissen, dass erforderliche Können und die überlebensnotwendigen Erfahrungen anzueignen, um auch in unübersichtlichen und sich rasch ändernden Situationen am Berg die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Das ist der springende Punkt. Erfahrung, die man sich über einen langen Zeitraum erworben hat, ist tatsächlich das Einzige, was einen wirklich schützen kann, Erfahrung und die Fähigkeit, zu verzichten.

Die linke Hand von Kim Hong-bin. 1991 verlor er bei einer Solobesteigung des Denali in Alaska nach schweren Erfrierungen sämtliche Finger an beiden Händen. Trotz dieser Behinderung bestieg er in Folge alle vierzehn Achttausender!! Ich begegnete ihm 2019 am Hidden Peak. Es war die Nummer 13 auf Kims Liste. Nach der erfolgreichen Besteigung seines 14. Achttausenders, dem Broad Peak, stürzte er beim Abstieg in den Tod!
Ende Teil 1
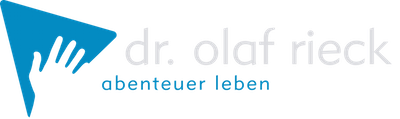









Ein wichtiger Aspekt ist auch die oft fehlende Selbstreflexion. Bin wieder unten angekommen, es ist nichts passiert – also alles richtig gemacht. Dass man aber vielleicht gerade so an einer Katastrophe vorbeigeschrammt ist, wird gerne übersehen. Dabei ist es sehr wichtig, sein Tun immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen. In den Bergen kann das überlebenswichtig sein.
Hallo Christian, vielen Dank für Deinen Kommentar. Ein äußerst wichtiger Aspekt! Nichts bringt einen weiter und ist lehrreicher, als über begangene Fehler nachzudenken. Unter anderem weil es oft nur reines Glück war, dass wir überhaupt noch nachdenken und Lehren daraus ziehen können.